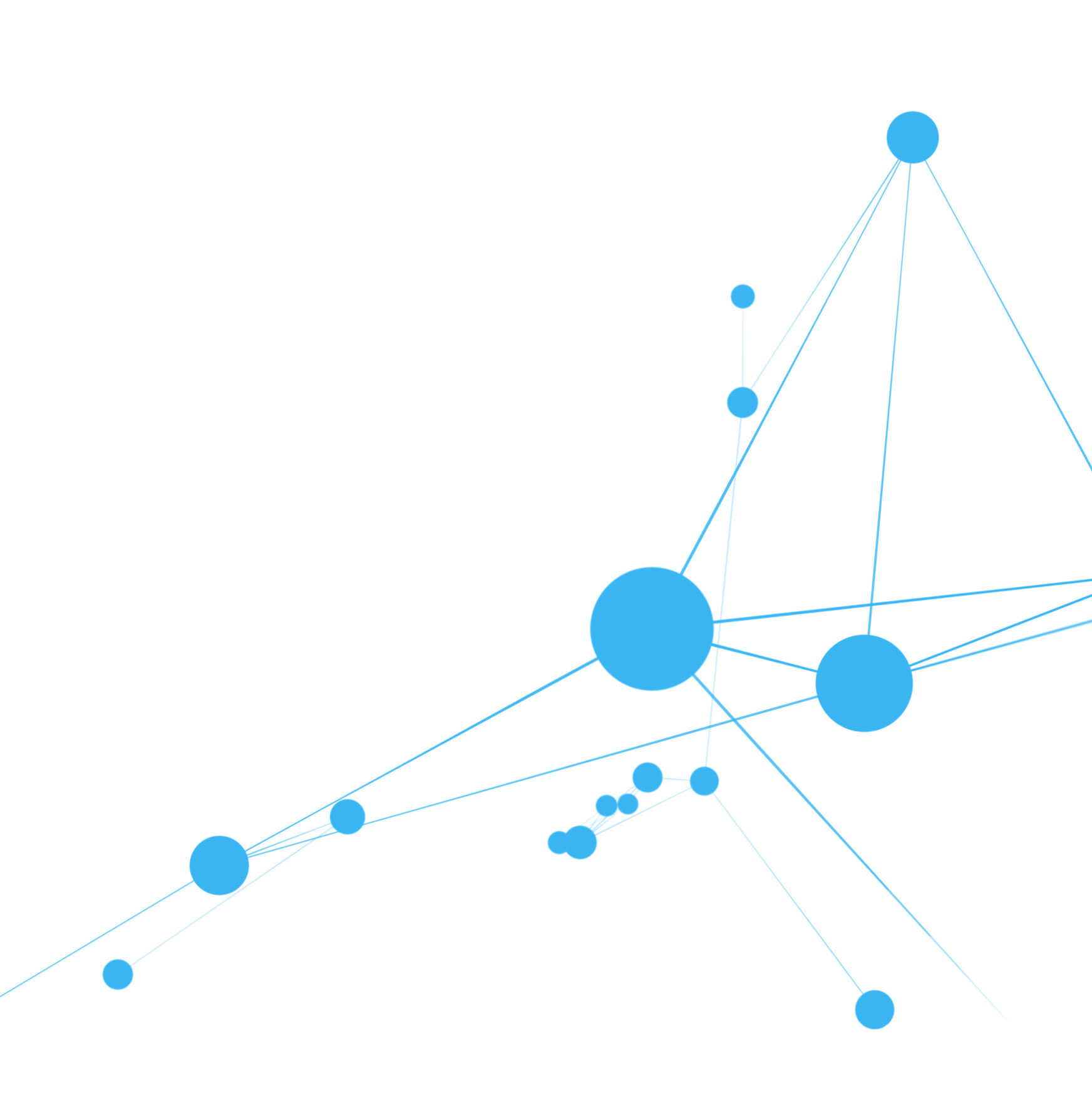D64 ist das Zentrum für Digitalen Fortschritt
D64 ist ein gemeinnütziger und unabhängiger Verein. Unsere über 800 Mitglieder begreifen die digitale Transformation als Chance, das Miteinander unserer modernen Gesellschaft zu verbessern. Wir gestalten in 13 Arbeitsgruppen die gesellschaftliche, ökologische, technologische und politische Entwicklung konstruktiv, kritisch und kreativ mit.
Die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität durch eine progressive Digitalpolitik zu verwirklichen, ist unser Ziel. Dafür wirken wir mit Hilfe der breitgefächerten Expertise unserer Mitglieder als unabhängiger Verein, der in allen Themenbereichen der Digitalisierung vordenkt und Impulse gibt.
Aktuelles

Digitalpolitik faschismussicher: Ein Rückblick auf den D64-Frühjahrsempfang 2024
Am 22.04.2024 diskutierten Felor Badenberg, Jeannette Gusko und Matthias Quent auf dem Frühjahrsempfang 2024 zu unserem Jahresthema "Digitalpolitik faschismussicher".
weiterlesen

Digitale Außenpolitik im Superwahljahr
D64 diskutiert mit Expert:innen über den Aufstieg des Autoritarismus und die Verteidigung der Demokratie in einer digitalen Welt
weiterlesen

D64 begrüßt das Ende der Vorratsdatenspeicherung
Berlin, 10. April 2024: Der Verein D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt, der sich für progressive Digitalpolitik einsetzt, begrüßt die in der Presse berichtete Einigung der Regierungskoalition auf das Quick-Freeze-Verfahren und die Nicht-Einführung der Vorratsdatenspeicherung. Dazu...
weiterlesen